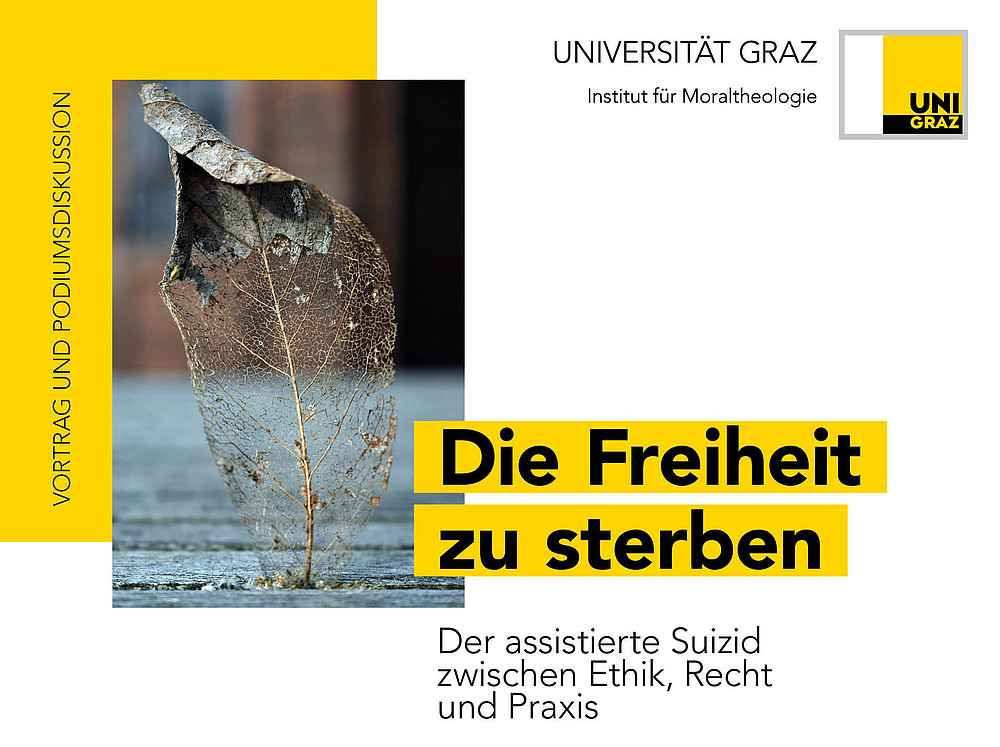Vom Wert des Glaubens
Die Rolle des Christentums in pluraler Gesellschaft
Am Donnerstag, 13. November 2025 fand unsere diesjährige Podiumsdiskussion zum Thema “Vom Wert des Glaubens. Die Rolle des Christentums in pluraler Gesellschaft” im Rahmen der Gesprächsreihe Moraltheologie aktuell in Kooperation mit der Katholischen Hochschulgemeinde Graz statt!
In einer zunehmend säkularen Gesellschaft steht auch das Christentum vor der Herausforderung, seine Rolle im öffentlichen Raum neu zu definieren. Welche Werte kann das Christentum heute noch vermitteln, um das Gemeinwohl zu fördern? Wie lassen sich jene erschließen? Und welchen Beitrag kann christlicher Glaube zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur persönlichen Lebensorientierung leisten? Eine Podiumsdiskussion widmet sich der Frage, wie christlicher Glaube Solidarität und Gerechtigkeit fördern kann, ohne politisch instrumentalisiert zu werden.
Am Podium:
Ulrich H. J. Körtner | Universitätsprofessor i. R. für Systematische Theologie und Religionswissenschaft,
Evangelisch-Theologische Fakultät, Universität Wien
Regina Polak | Universitätsprofessorin für Praktische Theologie und Interreligiösen Dialog,
Werteforscherin, Universität Wien
Detlef Pollack | Universitätsprofessor i.R. für Religionssoziologie, Religions- und Kultursoziologe,
Universtität Münster
Hier gelangen Sie zum Nachbericht in der Kathpress vom 14. November 2025
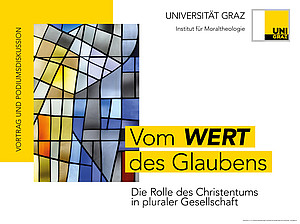
Das war die Auftaktveranstaltung zur neuen Gesprächsreihe MORALTHEOLOGIE AKTUELL
RÜCKBLICK - Großes Interesse an Podiumsdiskussion zum assistierten Suizid
Mehr als einhundert Interessierte haben am Donnerstag, den 21. November 2024 an dieser Veranstaltung teilgenommen. Unter dem Titel „Die Freiheit zu sterben. Der assistierte Suizid zwischen Ethik, Recht und Praxis“ widmeten sich hochkarätige Experten in Vorträgen und einer Podiumsdiskussion einem der zentralen ethischen und gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit.
Die Diskussion mit Alois Birklbauer, Gerold Muhri und Andreas Heller hat gezeigt, dass es bei diesem Thema nicht nur um die individuelle Freiheit von Betroffenen geht, sondern auch um die Gestaltung von Beziehungen. Denn im Zuge der fortschreitenden Privatisierung des Sterbens, so die Experten, wachse auch die Notwendigkeit, den mit Freiheitsgewinnen einhergehenden Freiheitslasten durch neue Formen der Begleitung und neue Sorgestrukturen zu begegnen. Deshalb sei nicht nur die Politik, sondern auch die gesamte Gesellschaft gefordert, ihren Beitrag dazu zu leisten.
Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit der Katholischen Hochschulgemeinde Graz durchgeführt.